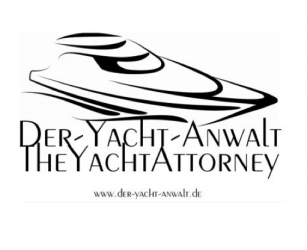Die unterschätzte Gefahr des Yacht-Arrests
Das Arrestrecht stellt im maritimen Bereich ein zentrales Instrument dar, um Gläubigern eine effektive Sicherung ihrer Ansprüche zu ermöglichen. Gerade im Chartergeschäft sind Eigner von Yachten jedoch oftmals nur unzureichend darauf vorbereitet, dass schon vergleichsweise kleine oder vermeintliche Forderungen zum Arrest ihrer Yacht führen können. Solche Arrestverfahren, die häufig im Wege eines einstweiligen Rechtsschutzes erwirkt werden, können massive wirtschaftliche Einbußen und Reputationsschäden nach sich ziehen. Besonders problematisch ist, dass die Yacht in dem Moment „verhaftet“ wird, in dem sie sich im Zuständigkeitsbereich eines bestimmten (oft fremden) Gerichts befindet, sodass Eigentum, Flaggenstaat oder Vertragssitz der Charteragentur eine untergeordnete Rolle spielen. Auf diese Weise ergeben sich komplexe internationale Zuständigkeiten, bei denen die rechtswahlvertragliche Bestimmung mitunter durch die tatsächliche Örtlichkeit des Schiffes ausgehebelt wird.
I. Rechtslage
Unterschiedliche Rechtsgrundlagen und internationale Komplexität
In der Praxis basieren Schiffsarreste auf einer Mischung aus internationalem Übereinkommen und nationalem Recht. Dabei kommt dem Internationalen Übereinkommen über die Verhaftung von Seeschiffen von 1952 (Arrestübereinkommen 1952) besondere Bedeutung zu. Dieses findet jedoch nur Anwendung, wenn
- der Staat, in dem der Arrest beantragt wird, Vertragspartei ist, und
- der Flaggenstaat der Yacht ebenfalls dem Übereinkommen beigetreten ist.
Viele Staaten – darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien und Spanien – sind Teil des Arrestübereinkommens 1952. Andere, wie Malta, haben eigene nationale Regelungen. In jedem Fall wird der Arrest in dem Land vollzogen, in dem sich die Yacht gerade befindet. Die Gesetzgebung dieses Landes bestimmt Ablauf und Voraussetzungen des Arrestverfahrens.
Deutschland
Deutschland hat das 1952er-Übereinkommen ratifiziert und setzt ergänzend auf nationale Regelungen in der Zivilprozessordnung (ZPO).
- § 917 ZPO regelt den dinglichen Arrest. Er erfordert, dass zu befürchten ist, eine Vollstreckung könne ohne den Arrest vereitelt oder erschwert werden.
- § 945 ZPO sieht vor, dass der Antragsteller für alle Schäden haftet, wenn sich der Arrest als ungerechtfertigt erweist. Zwar ist die Haftung verschuldensunabhängig, doch in der Praxis tun sich Betroffene oft schwer, den vollen Schaden ersetzt zu bekommen.
Frankreich
Frankreich ist ebenfalls Vertragsstaat des Übereinkommens von 1952. Im Code des Transports (Transportgesetzbuch) finden sich spezifische Bestimmungen zum Vorgehen bei Schiffsarrest. Das Gericht prüft meist nur summarisch den Anspruch, sodass auch scheinbar geringfügige Forderungen zur Verhaftung führen können. Bei unrechtmäßigen Arresten kann zwar Ersatz des entstandenen Schadens verlangt werden, aber die französische Rechtsprechung verlangt zumeist den Nachweis bösen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit – eine hohe Hürde.
Italien
Auch Italien folgt dem 1952er-Übereinkommen und ergänzend dem Codice della Navigazione.
- Artikel 646 Codice della Navigazione erlaubt den Arrest zur Sicherung von maritimen Forderungen, wozu Charterforderungen zählen können.
- Für Schadensersatz wegen unrechtmäßiger Arreste fordern italienische Gerichte zumeist den Nachweis böser Absicht oder grober Fahrlässigkeit. Aufgrund dieser Beweishürden gehen viele geschädigte Eigner leer aus oder erhalten nur Teilersatz.
Kroatien
Kroatien hat das Arrestübereinkommen ratifiziert und setzt die internationalen Vorgaben in sein maritimes Gesetz (Maritime Act) um. Hier erfolgt der Schiffsarrest als vorläufige Sicherungsmaßnahme. Obwohl das Prinzip der Arresthaftung grundsätzlich anerkannt wird, ist es in der Praxis ähnlich schwierig wie in anderen Ländern, einen vollen Schadensersatz durchzusetzen. Aus Eignersicht verschärft sich das Risiko dadurch, dass ein Charterstreit mitunter zum Arrest führen kann, selbst wenn die Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig beim Vertragsgegner liegen (z.?B. separate Holdingstrukturen).
Malta
Malta ist kein Vertragsstaat des Übereinkommens von 1952. Dennoch bestehen in maltesischen Gesetzen – insbesondere im Code of Organisation and Civil Procedure (COCP) – umfangreiche Regeln zum Schiffsarrest. Die Praxis kennt schnelle Verfahren („Schnellarrest“) mit geringer Begründungstiefe. Zwar lassen maltesische Gerichte prinzipiell Schadensersatzansprüche bei unrechtmäßigen Arresten zu, doch setzt dies den Nachweis „böser Absicht oder Leichtfertigkeit“ voraus, was sehr schwer zu belegen ist.
Spanien
Spanien hat seine Regelungen zum Schiffsarrest insbesondere in Gesetz 2/1967 verankert. Dieses befreit den Antragsteller weitgehend von formellen Nachweispflichten, um ein ausländisches Schiff möglichst unkompliziert arrestieren zu können. Die Kehrseite sind potenziell missbräuchliche Arrestverfahren; Schadensersatzforderungen werden zwar grundsätzlich anerkannt, aber auch hier ist der Nachweis missbräuchlichen Handelns schwierig.
Das zentrale Problem: Rechtsanwendung am Ort des Schiffes
Die Praxis zeigt, dass Eigentümergesellschaft, Flaggenstaat oder eine anderslautende Gerichtsstands- bzw. Rechtswahlklausel im Chartervertrag nur bedingt helfen, wenn die Yacht sich gerade in einer Rechtsordnung befindet, die eine schnelle und womöglich leichtfertige Arrestierung zulässt. So lässt sich etwa im vorgestellten Beispiel ein Arrest in Kroatien nicht verhindern, nur weil die Yacht maltesische Flagge führt und die Vermarktungsgesellschaft ebenso in Malta ansässig ist.
- Grundsätzlich gilt: Das örtliche Gericht, in dessen Hafenbereich sich die Yacht befindet, wendet primär das nationale Recht an, wobei internationale Übereinkommen und Kollisionsregeln berücksichtigt werden können.
Wirtschaftliche, rechtliche und reputationsbezogene Folgen
Direkte finanzielle Einbußen
Wird eine Yacht – insbesondere eine im Charterbetrieb – arrestiert, kommt es zu unmittelbaren Ausfällen bei Chartereinnahmen und möglichen Vertragsstrafen oder Erstattungsansprüchen gegenüber den zahlenden Gästen. Hinzu kommen Anwalts- und Gerichtskosten, die oft im Eilverfahren auflaufen.
Reputationsschäden
Ein öffentlich bekannter Arrest kann das Image der Yacht nachhaltig beeinträchtigen. Charterkunden, die von solch einem Vorfall erfahren, könnten sich zukünftig für andere Angebote entscheiden. Auch Banken und Versicherer bewerten solche Vorfälle häufig negativ.
Langfristige Unsicherheiten
Selbst nach Aufhebung eines unrechtmäßigen Arrestes erhalten Eigner häufig nur teilweise Schadenskompensation. So bleiben sie auf einem hohen Kostenanteil sitzen. Diese Unsicherheit wirkt sich langfristig auf die Bereitschaft aus, die Yacht kommerziell zu nutzen oder bestimmte Häfen anzulaufen.
Präventions- und Lösungsansätze
Vertragliche Maßnahmen
- Individuelle Charterverträge:
- Eindeutige Eigentums- und Besitzverhältnisse darlegen.
- Haftungsklauseln bei unrechtmäßigem Arrest oder vertragliche Vertragsstrafen.
- Vorzugsweise Schiedsvereinbarungen und Rechtswahlklause (wobei letztere durch den tatsächlichen Arrestort beeinträchtigt werden kann).
- Sicherheitsleistungen:
- Letter of Undertaking (LOU) über den P&I-Versicherer. Damit kann die Yacht gegebenenfalls rasch aus dem Arrest entlassen werden.
- Bankgarantien oder Kautionen, sofern sich der Gläubiger darauf einlässt.
Strukturelle und organisatorische Maßnahmen
- Trennung von Eigentum und Betrieb:
- Eigentümergesellschaft (z.?B. als Special Purpose Vehicle/SPV) hält ausschließlich das Schiff, während eine getrennte Betriebsgesellschaft die Chartergeschäfte abwickelt. So lässt sich das Risiko verteilen.
- Jurisdiktionswahl bei Gründung:
- Yacht-Eigner sollten überlegen, in welchen Gewässern sich die Yacht primär bewegt und dortige Arrestbedingungen prüfen.
- Soweit möglich, Häfen in Staaten meiden, in denen die Arrestpraxis besonders rasch und formalarm verläuft (z.?B. manche Häfen im Mittelmeerraum).
Versicherungstechnische Absicherung
- P&I-Versicherung:
- Spezielle Deckungen für Charteryachten und Arrestfälle.
- Über P&I-Clubs können LOUs gestellt werden, die eine schnelle Freigabe ermöglichen.
- Spezialisierte Versicherungen:
- Charter-Ausfallversicherung zum Ausgleich entgangener Einnahmen.
- In Einzelfällen Reputationsschadenversicherungen.
Proaktives Monitoring und Krisenmanagement
- Frühwarnsysteme:
- Überwachen der Gerichts- und Hafenregister in den wichtigsten Anlaufhäfen, um bevorstehende Anträge zu erkennen.
- Krisenstab:
- Klare interne Abläufe für den Fall eines Arrestes, sofortige Kontaktaufnahme mit spezialisierten Anwälten vor Ort, rasche Koordination von Sicherheitsleistungen und Dokumentation aller Schäden.
Grenzen der Rechtswahl in der Arrestpraxis
Vertraglich vereinbarte Schieds- oder Gerichtsstandsklauseln geben zwar grundsätzlich einen Rahmen vor. Dennoch bleibt das „lex fori“-Prinzip in Arrestfällen vorherrschend: Das Gericht desjenigen Landes, in dem die Yacht liegt oder angehalten wird, ist zuständig und wendet sein eigenes Prozessrecht und materielle Sicherungsrecht an. Auch eine vorteilhafte Rechtswahl kann sich daher de facto als wirkungslos erweisen, wenn das nationale Recht am Ort des Arrestes ein schnelles Verfahren ohne hohe Nachweishürden ermöglicht.
Ein präsenter Lösungsansatz besteht darin, sichernde Maßnahmen im Schieds- oder Gerichtsverfahren vertraglich zu beschränken oder auszuschließen. In manchen Jurisdiktionen (insbesondere bei Common Law-Systemen) ist dies jedoch nur eingeschränkt umsetzbar, da ein staatliches Gericht sich auf seine hoheitlichen Befugnisse berufen kann, um einen Arrest ungeachtet einer Schiedsvereinbarung anzuordnen. Hinzu kommt, dass einzelne Rechtsordnungen (wie Deutschland mit §?1033 ZPO) einstweilige Maßnahmen trotz Schiedsklausel erlauben. Eine komplette Ausschaltung staatlicher Arrestmechanismen ist somit selten möglich.
Zwischenfazit und Ausblick
Das internationale Recht des Yacht-Arrests zeigt sich äußerst uneinheitlich und für Eigentümer kommerziell genutzter Charteryachten potenziell existenzbedrohend. Bereits geringfügige Forderungen können zum Arrest führen, während die Geltendmachung von Schadensersatz bei unrechtmäßiger Arrestierung sich aufgrund hoher Beweisanforderungen oft als langwierig und nur teilkompensierend erweist.
- Zentraler neuralgischer Punkt: Das Recht des Ortes, an dem sich die Yacht gerade physisch befindet, ist ausschlaggebend für die Arrestpraxis und überschreibt viele vertraglich getroffene Vereinbarungen.
- Praxisnahe Prävention: Eigentümer sollten eine mehrstufige Absicherung in Betracht ziehen, bestehend aus (1) sorgfältiger vertraglicher Gestaltung, (2) passender Unternehmens- und Holdingstruktur, (3) intensiver Versicherungsabdeckung (P&I-Deckung, Charterausfallversicherung), (4) proaktivem Monitoring der möglichen Hafengerichte und (5) eingespielten Reaktionsplänen.
- Internationaler Harmonisierungsbedarf: Langfristig wäre eine vereinheitlichte Regelung auf EU-Ebene oder eine Modernisierung des internationalen Arrestrechts wünschenswert, um die oftmals unzureichende Entschädigungslage bei unrechtmäßigen Arresten zu verbessern.
Angesichts der hohen wirtschaftlichen Werte, die mit größeren und kommerziell genutzten Yachten verbunden sind, ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Arrestproblematik für Eigner unverzichtbar. Nur durch ein integriertes Vorsorge- und Krisenmanagement lässt sich der Schutz so weit stärken, dass ein unberechtigter oder überzogener Arrest nicht zu einer existenziellen Bedrohung für das gesamte Charter- und Eigner-Konzept wird.
II. Lösungsansätze
Nach aktueller Rechtslage in vielen maritimen Jurisdiktionen – unabhängig davon, ob sie dem Arrestübereinkommen von 1952 unterliegen oder nicht – steht der Schiffsarrest in einem Spannungsverhältnis zwischen dem berechtigten Interesse des Gläubigers, seine Ansprüche effektiv zu sichern, und dem Eigentums- und Unternehmerschutz des Yacht-Eigners. Sobald bereits geringe Forderungen durchgesetzt werden sollen, kann ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen, wenn eine hochpreisige Yacht über Tage oder Wochen blockiert wird und Charteraufträge ausfallen. Dies widerspricht dem allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und führt vielfach zu einer faktischen Entrechtung des Yacht-Eigners, weil er in der Praxis kaum eine Chance hat, den entstandenen Schaden zurückzuerlangen. Im Folgenden werden – basierend auf internationaler und nationaler Perspektive – mögliche Gesetzes- und Regelungsänderungen aufgezeigt, um die Haftung für unrechtmäßige oder unverhältnismäßige Arreste stärker auf den Antragsteller zu verlagern und so Rechtsstaatlichkeit wie Verhältnismäßigkeit wiederherzustellen.
1.1 Aktuelle Situation
In vielen Rechtsordnungen – etwa in Deutschland (§?945 ZPO), Frankreich oder Italien – existieren bereits Schadensersatzansprüche gegen den Arrestantragsteller, wenn sich der Arrest als von Anfang an ungerechtfertigt herausstellt. Allerdings greift diese Haftung meistens nur bei (1) klarer Begründungslosigkeit oder (2) bösem Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit. Dadurch entsteht eine hohe Beweislast für den Yacht-Eigner, der in der Praxis oft nur mangelhaft kompensiert wird.
1.2 Reformvorschläge
- Strikte Kausalhaftung (strict liability) für Arrestschäden
Eine Möglichkeit wäre, gesetzlich festzuschreiben, dass der Antragssteller für sämtliche Schäden haftet, sobald sich der Arrestanspruch als unbegründet oder jedenfalls nicht in der geltend gemachten Höhe durchsetzbar erweist, ohne dass dem Antragsteller böser Glaube oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden muss.- Vorteil: Yacht-Eigner werden rechtssicher entschädigt.
- Nachteil: Gläubiger könnten aus Angst vor Haftungsfolgen seltener zum Arrest greifen, was bei berechtigten Forderungen deren Durchsetzung erschwert.
- Umkehr der Beweislast
Wo ein striktes Verschuldensprinzip politisch oder rechtlich schwer durchzusetzen ist, ließe sich ein Mittelweg einführen, wonach der Arrestantragsteller darlegen und beweisen muss, dass er den Arrestantrag bei zutreffender Sorgfalt stellen durfte. Gelingt ihm das nicht, haftet er für sämtliche Folgeschäden. - Proportionalitätsklauseln
Gesetzlich könnte vorgeschrieben werden, dass die Höhe des Arrestes (bzw. der Wert des sichergestellten Objekts) in einem angemessenen Verhältnis zur streitigen Forderung stehen muss. Ist die Yacht um ein Vielfaches wertvoller als die geltend gemachte Forderung, wäre ein Totalarrest nur in Ausnahmefällen möglich. Eine Verletzung dieser Proportionalität begründet vollumfängliche Schadenersatzpflicht.
2. Pflicht zur Sicherheitsleistung des Antragstellers
2.1 Zweck und Status quo
Um den Gläubiger vor Missbrauch zu schützen, verlangen einige Länder (z.?B. Spanien) bereits eine Sicherheitsleistung oder Bankbürgschaft des Antragstellers, bevor er einen Schiffsarrest erwirken kann. In Deutschland ist dies nach dem Grundsatz des §?921 ZPO möglich, aber nicht in jedem Fall zwingend vorgeschrieben. In vielen anderen Jurisdiktionen wird die Sicherheitserbringung äußerst selten angeordnet.
2.2 Reformvorschläge
- Obligatorische Sicherheitsleistung
Für jeden Arrestantrag sollte der Gläubiger eine angemessene Kaution oder Bankgarantie stellen müssen. Bei Aufhebung des Arrestes könnte der Geschädigte daraus sofort entschädigt werden.- Praktische Ausgestaltung: Die Höhe der Sicherheitsleistung müsste sich am voraussichtlichen Schaden orientieren, den ein mehrtägiger bis mehrwöchiger Charterausfall verursacht.
- Flexible Anordnungspflicht
Eine etwas flexiblere Variante besteht darin, dass die Gerichte zwar die Möglichkeit haben, eine Sicherheit zu verlangen, sie aber über eine klare gesetzliche Vorgabe verfügen, wann dies zwingend zu erfolgen hat (z.?B. bei disproportional hohem Schiffs- oder Yachtwert).
3. Einheitliche Mindeststandards auf internationaler Ebene
3.1 Notwendigkeit eines internationalen Ansatzes
Gerade im Yachtgeschäft ist der „Fluchtpunkt der Yacht“ entscheidend: Eigentümer und Flaggenstaat spielen oft nur eine untergeordnete Rolle, wenn die Yacht sich in fremden Hoheitsgewässern befindet. Deshalb wäre eine nationale Reform zwar hilfreich, löst aber nicht das grundlegende Problem. Eine europäische oder internationale Initiative könnte gemeinsame Mindeststandards für Arrest und Haftung definieren.
3.2 Möglichkeiten
- EU-weite Richtlinie oder Verordnung
Die EU hat bereits in anderen Bereichen (z.?B. Europäischer Vollstreckungstitel, Europäischer Zahlungsbefehl) einheitliche Maßnahmen geschaffen. Ein „EU-Arrest-Regime“ könnte vorsehen:- Einheitliche Voraussetzungen für den Arrest.
- Obligatorische Sicherheitsleistungen für den Antragsteller.
- Strenge Haftungsregeln bei unrechtmäßiger Arrestierung.
- Definierte Zuständigkeiten, um Forum-Shopping zu verhindern.
- Modernisierung des Arrestübereinkommens
Das Arrestübereinkommen 1952 ist in die Jahre gekommen; alternative Konventionen (z.?B. das Übereinkommen von 1999) sind nicht flächendeckend ratifiziert. Eine internationale Konferenz (z.?B. über die IMO oder CMI) könnte eine Reform anstoßen, um das Haftungsregime im Falle eines unrechtmäßigen Arrestes an die heutige Charter- und Superyachtpraxis anzupassen.
4. Einführung spezifischer Gerichtsverfahren gegen unverhältnismäßige Arreste
4.1 Beschleunigte Schutzmechanismen
Um zu verhindern, dass ein Yacht-Eigner tagelang auf die Entscheidung zur Aufhebung des Arrestes warten muss, könnten Staaten in ihre Verfahrensordnungen kurze Fristen und beschleunigte Beschwerdeverfahren einführen. Denkbar wäre ein Rechtsbehelf, bei dem der Eigner binnen 24 Stunden Gehör vor Gericht erhält, um offensichtlich unverhältnismäßige oder offensichtlich rechtswidrige Arrestanträge rasch aufheben zu lassen.
4.2 Zusammenwirken mit Schiedsvereinbarungen
In vielen (Charter-)Verträgen bestehen Schiedsklauseln, die aber wegen der staatlichen Hoheitsgewalt beim Arrest nur begrenzt verhindern, dass ein nationales Gericht den Arrest ausspricht. Ein möglicher Kompromiss wäre ein „schiedsgerichtlicher Vorbehalt“, wonach ein Schiedsgericht zumindest ex post schnell über die Berechtigung entscheiden kann und das staatliche Gericht die Yacht nur bis zu dieser Schiedsentscheidung arrestiert.
5. Proportionalitätsgrundsatz und Beschränkungsmodelle
5.1 Deckelung des Sicherungsumfangs
Falls eine Forderung beispielsweise lediglich 10.000 Euro beträgt, gleichzeitig aber eine Yacht im Wert von mehreren Millionen Euro festgesetzt wird, ist das Spannungsverhältnis evident. Daher könnte man gesetzlich vorschreiben, dass:
- Nur so viel „arrestiert“ wird, wie zur Sicherung der Forderung und ihrer Prozesskosten wirklich erforderlich ist (z.?B. Arrest auf Chartererträge oder Versicherungsansprüche statt auf die ganze Yacht).
- „Arrest light“: Sacharrest nur, wenn keine anderen Vermögenswerte rasch greifbar sind oder der Gläubiger substantiiert darlegt, warum nur die Yacht selbst geeignet ist.
5.2 Sicherung auf Chartererträge oder Versicherungsleistungen
Eine fortschrittliche Regelung könnte zudem dem Gläubiger vorschreiben, zuerst in Chartereinnahmen, Versicherungsleistungen oder Kontoguthaben zu vollstrecken, ehe ein Totalarrest über die Yacht erfolgt. Das würde den Eigentümer weniger hart treffen und gleichzeitig das Gläubigerinteresse wahren.
6. Verbesserung des Schadenersatzes durch klare Bemessungsregeln
6.1 Konkreter Schaden oder Pauschalen?
In vielen Verfahren fällt es Eignern schwer, den genauen Schaden zu beziffern (z.?B. verlorene Charterverträge, Imageschäden). Gesetzliche Pauschalierungen oder Indizierungen wären denkbar:
- Pauschalen pro Tag des Arrests, die sich an den üblichen Charterraten orientieren.
- Beweislastumkehr: Ist der Arrest rechtswidrig, wird vermutet, dass sämtliche bestätigten Charterausfälle zu 100?% zu ersetzen sind, ohne dass der Eigner die einzelnen Buchungen haarklein nachweisen muss.
6.2 Berücksichtigung von Reputations- und Folgeschäden
Eine systematische Kodifizierung, die immaterielle oder Folgeschäden anerkennt, könnte die Gerichte anleiten, auch Einbußen bei Vermarktung und Wertminderung zu berücksichtigen. Dies müsste freilich durch angemessene Entlastungsmöglichkeiten des Arrestantragstellers ergänzt werden.
7. Zusammenfassung: Kernpunkte für eine rechtsstaatlichere Lösung
- Stärkere Haftung des Antragstellers: Ein modifiziertes Haftungsregime – entweder als strikte Kausalhaftung oder mit Beweislastumkehr – stellt sicher, dass Geschädigte für Arrestkosten (einschließlich Folgeschäden) realistisch entschädigt werden.
- Obligatorische Sicherheitsleistung: Um Missbräuche zu verhindern, sollten Gerichte bei Arrestanträgen zwingend eine angemessene Kaution verlangen, die bei ungerechtfertigter oder unverhältnismäßiger Maßnahme dem Eigner zur Deckung des Schadens zugutekommt.
- Proportionalitätsprinzip: Ein gesetzliches Gebot, wonach nur in angemessenem Umfang (Wert der Forderung zzgl. Prozesskosten und Zinsen) arrestiert werden darf und das Gericht unverhältnismäßige Arreste von Amts wegen zu begrenzen hat.
- Beschleunigte Überprüfung: Einrichtung von Schnellverfahren (z.?B. kurze Anhörungsfrist) oder klaren Beschwerdemöglichkeiten, damit ein unrechtmäßiger Arrest innerhalb von 24–72 Stunden aufgehoben werden kann, anstatt wochenlang zu dauern.
- Internationale Harmonisierung: Eine (EU-weite) Richtlinie oder eine Modernisierung des Arrestübereinkommens könnte einheitliche Mindeststandards schaffen. Gerade bei Charteryachten, die in vielen Mittelmeer-Staaten kreuzen, müsste ein einheitlicher Schutz geschaffen werden.
- Pauschale Schadensbemessung: Wenn sich ein Arrest als ungerechtfertigt erweist, sollte der Yacht-Eigner automatisch bestimmte Entschädigungsansprüche (z.?B. tägliche Pauschalen nach Charterpreisen) bekommen, ohne komplizierte Schadensnachweise führen zu müssen.
Fazit
Die derzeitige Rechtslage ermöglicht in vielen Staaten Arreste von Yachten, die zu hohem wirtschaftlichen Schaden führen können, selbst wenn der zu sichernde Anspruch vergleichsweise gering ist und sich später als unberechtigt herausstellt. Dies ist weder im Sinne einer funktionierenden maritimen Wirtschaft noch entspricht es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Gesetzliche Reformschritte, die die Haftung des Antragstellers verschärfen, eine obligatorische Sicherheitsleistung vorsehen und zugleich eine schnellere gerichtliche Prüfung garantieren, könnten dem Missbrauch entgegenwirken.
Langfristig sollte ein international einheitlicher Ansatz verfolgt werden, insbesondere über eine Reform des Arrestübereinkommens oder über EU-weite Mindeststandards, damit Geschädigte bei unverhältnismäßigen Arrestierungen abgesichert sind. Ein klarer, stringenter Rechtsrahmen würde sicherstellen, dass das legitime Interesse von Gläubigern gewahrt bleibt, ohne dass Yacht-Eigner unverhältnismäßige Risiken tragen müssen.
The Underestimated Risk of Yacht Arrest
Arrest law plays a central role in maritime matters, enabling creditors to effectively secure their claims. In the charter business in particular, yacht owners are often inadequately prepared for the fact that even relatively small or alleged claims can lead to their yacht being arrested. Such arrest proceedings, frequently initiated by way of interim relief, can cause massive economic losses and reputational damage. A particular issue is that a yacht is “arrested” the moment it enters the jurisdiction of a specific (often foreign) court, making the property’s owner, the flag state or the charter agency’s registered seat of only secondary importance. This creates complex international competences, where a contractually agreed choice of law may be overridden by the actual location of the vessel.
I. Legal Framework
Different Legal Foundations and International Complexity
In practice, ship arrests are based on a combination of international conventions and national law. Of particular importance is the International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships of 1952 (the 1952 Arrest Convention). However, this convention only applies if:
- the state in which the arrest is requested is a contracting party, and
- the flag state of the yacht has also acceded to the convention.
Many states – including Germany, France, Italy, Croatia and Spain – are party to the 1952 Arrest Convention. Others, such as Malta, have their own national regulations. In any event, the arrest is enforced in the country where the yacht is physically located. The legislation of that country determines the procedure and requirements for the arrest.
Germany
Germany has ratified the 1952 Convention and supplements it with national provisions in the Zivilprozessordnung (ZPO – German Code of Civil Procedure).
- Section 917 ZPO governs the dinglicher Arrest (proprietary arrest). It requires a plausible concern that enforcement (of the underlying claim) would be thwarted or significantly hindered without the arrest.
- Section 945 ZPO provides that the applicant is liable for all damages if the arrest proves to have been unjustified. Although this liability is strict (i.e. independent of fault), in practice affected parties often struggle to obtain full compensation.
France
France is also a contracting state to the 1952 Convention. The Code des Transports (Transport Code) contains specific provisions regarding ship arrest. The court generally conducts only a summary examination of the claim, meaning that even seemingly minor claims can lead to an arrest. Although compensation for damages can be claimed if the arrest proves wrongful, French case law often requires proof of malicious intent or gross negligence – a high hurdle.
Italy
Italy likewise follows the 1952 Convention and supplements it with the Codice della Navigazione (Italian Navigation Code).
- Article 646 Codice della Navigazione permits the arrest to secure maritime claims, which can include charter-related claims.
- For damages arising from wrongful arrests, Italian courts typically require evidence of malicious intent or gross negligence. Due to these evidentiary hurdles, many harmed owners are left empty-handed or receive only partial compensation.
Croatia
Croatia has ratified the Arrest Convention and implements the international requirements in its Maritime Act. Ship arrest here is treated as a provisional security measure. Although the principle of liability for wrongful arrest is generally recognised, in practice it is as difficult as in other jurisdictions to obtain full compensation. From the owner’s perspective, the risk is heightened by the possibility that a charter dispute may lead to arrest even when ownership structures are not clearly held by the contracting party (e.g. separate holding structures).
Malta
Malta is not a contracting state to the 1952 Convention. Nevertheless, Maltese law – particularly the Code of Organisation and Civil Procedure (COCP) – contains extensive rules on ship arrest. In practice, there are swift (“fast-track”) arrest procedures with minimal requirements. Although Maltese courts principally allow claims for damages in the event of a wrongful arrest, they often require evidence of “malicious intent or recklessness”, which is very difficult to prove.
Spain
Spain has enshrined its regulations on ship arrest primarily in Law 2/1967. This law largely frees the applicant from formal requirements, enabling a foreign vessel to be arrested as simply as possible. The downside is the potential for abusive arrest proceedings; although claims for damages are recognised in principle, it remains difficult to prove abusive conduct.
The Central Problem: Law Applied Where the Ship Is Located
Practice shows that corporate ownership, flag state, or a different choice-of-court or choice-of-law clause in a charter contract provides only limited protection if the yacht happens to be located in a jurisdiction that permits swift and perhaps negligent arrests. For example, in the scenario outlined above, an arrest in Croatia cannot be prevented merely because the yacht is registered under the Maltese flag and the charter agency is likewise based in Malta.
As a rule, the local court in whose port area the yacht is located primarily applies its own national law, although international conventions and conflict-of-law rules may also be taken into account.
Economic, Legal and Reputational Consequences
- Direct Financial Losses
If a yacht – particularly one in active charter service – is arrested, there is an immediate loss of charter income as well as possible contractual penalties or refund claims from paying guests. Added to this are legal and court costs, which often escalate in expedited proceedings. - Reputational Damage
A publicly known arrest can permanently damage the yacht’s image. Charter clients who hear of such an incident may opt for alternative offerings in the future. Banks and insurers likewise often take a negative view of such occurrences. - Long-term Uncertainty
Even after an unjustified arrest is lifted, owners often receive only partial compensation. They may have to bear a significant portion of the costs themselves. This uncertainty influences owners’ willingness to continue commercial charters or to visit certain ports in the future.
Prevention and Possible Solutions
Contractual Measures
- Tailored Charter Contracts:
- Clearly set out ownership and possession structures.
- Include liability clauses in the event of wrongful arrest or contractual penalties.
- Ideally include arbitration agreements and choice-of-law clauses (although these can be impacted by the actual arrest location).
- Securities:
- Letter of Undertaking (LOU) from the P&I insurer, allowing a quick release from arrest if necessary.
- Bank guarantees or cash deposits, where the creditor agrees to accept them.
Structural and Organisational Measures
- Separating Ownership from Operations:
- The ownership company (e.g. a special purpose vehicle/SPV) holds only the yacht, while a separate operating company handles the charter business. This helps distribute risk.
- Choosing the Jurisdiction at Set-Up:
- Yacht owners should consider in which waters their yacht mainly operates and review the conditions for arrest there.
- As far as possible, avoid ports in states where arrest proceedings happen particularly swiftly and with minimal formalities (e.g. certain harbours in the Mediterranean region).
Insurance Protection
- P&I Insurance:
- Specialised cover for charter yachts and arrest scenarios.
- P&I clubs can issue LOUs that facilitate rapid release.
- Specialised Insurance:
- Charter-income protection to compensate for lost earnings.
- In some cases, insurance against reputational damage.
Proactive Monitoring and Crisis Management
- Early-Warning Systems:
- Monitoring court and port registers in the main destination ports to detect pending applications promptly.
- Crisis Team:
- Clear internal procedures to follow in the event of arrest, immediate contact with specialised local lawyers, rapid provision of security, and detailed record-keeping of all damages.
Limits to Choice of Law in Arrest Practice
Although a contractual arbitration or jurisdiction clause basically provides a framework, the lex fori principle remains dominant in arrest proceedings: the court of the country where the yacht is located or held is competent and applies its own procedural and substantive security law. Consequently, even a carefully chosen beneficial law may prove effectively meaningless if the national law in the place of arrest allows swift proceedings with low evidentiary barriers.
One possible approach is to limit or exclude interim measures in a contract’s arbitration or choice-of-court agreement. However, in certain jurisdictions (especially common law systems), this can only be implemented to a limited extent, given that a national court may invoke its sovereign authority to order an arrest regardless of an arbitration agreement. Additionally, some legal systems (such as Germany, pursuant to Section 1033 ZPO) permit interim measures even where a valid arbitration clause exists. Completely ruling out state enforcement (arrest) mechanisms is thus seldom feasible.
Preliminary Conclusion and Outlook
The international law surrounding yacht arrest is highly fragmented and presents a potentially existential threat to owners of commercially operated charter yachts. Even minor claims can result in an arrest, while securing compensation for wrongful arrest can be lengthy and only partially successful due to high evidentiary thresholds.
The core issue: The law of the place where the yacht is physically located is decisive for the arrest practice and supersedes many contractual arrangements.
Practical Prevention: Owners should consider a multi-layered risk management strategy, including (1) meticulous contractual drafting, (2) suitable corporate and holding structures, (3) comprehensive insurance coverage (P&I cover, charter-income insurance), (4) proactive monitoring of possible port jurisdictions, and (5) well-prepared response plans.
International Need for Harmonisation: In the long term, an EU-wide or international harmonisation would be desirable to address the often inadequate compensation framework for wrongful arrests. Given the significant financial values associated with larger and commercially operated yachts, it is indispensable for owners to address the risk of arrest at an early stage. Only through an integrated prevention and crisis management strategy can owners ensure that an unjustified or excessive arrest does not pose an existential threat to their entire charter and ownership concept.
II. Proposed Solutions
Under the current legal situation in many maritime jurisdictions – regardless of whether they are subject to the 1952 Arrest Convention – ship arrest exists in a tension between the legitimate interest of creditors in effectively securing their claims and the property and entrepreneurial protections of yacht owners. Even minor claims can cause disproportionately large losses if a high-value yacht is blocked for days or weeks, leading to cancelled charter bookings. This contravenes the general principle of proportionality and often results in the yacht owner effectively being deprived of remedies, as in practice it is extremely difficult to recover the losses. The following points propose possible legislative and regulatory changes, from both an international and national perspective, aiming to place greater liability on applicants for wrongful or disproportionate arrests. This would restore the rule of law and proportionality.
1.1 Current Situation
In many legal systems – for instance in Germany (§?945 ZPO), France, and Italy – there are indeed provisions for damages against the party seeking arrest if the arrest is later deemed unjustified from the outset. However, such liability typically only arises in cases of (1) clearly unsubstantiated claims or (2) malicious intent or gross negligence. This places a significant burden of proof on yacht owners, who often fail to achieve full compensation in practice.
1.2 Reform Proposals
- Strict Liability for Arrest Damages
One option would be to impose strict liability on the arrest applicant for all resulting damages as soon as it becomes clear that the arrest claim was unfounded or at least not enforceable for the amount sought, without requiring proof of the applicant’s bad faith or negligence.- Advantage: Yacht owners can be compensated with greater certainty.
- Disadvantage: Creditors might be deterred from using arrest even for legitimate claims, complicating the enforcement of their rights.
- Reversal of the Burden of Proof
If fully strict liability is politically or legally hard to implement, a middle ground would be to require the applicant to prove that they had reasonable grounds, applying due care, to request the arrest. If they fail to do so, they would be liable for all consequential losses. - Proportionality Clauses
Legislation could mandate that the value of the arrest (i.e. the object seized) must be proportionate to the claim at issue. If the yacht’s value is many times higher than the amount of the claim, a total arrest should only be permissible in exceptional cases. Breaching this proportionality would create full liability for damages.
2. Obligation on the Applicant to Provide Security
2.1 Purpose and Status Quo
To protect owners from abusive arrests, some countries (e.g. Spain) already require the applicant to provide security or a bank guarantee before effecting a ship arrest. In Germany, this is possible under Section 921 ZPO, but not mandatory in all cases. In many other jurisdictions, courts rarely order the provision of security.
2.2 Reform Suggestions
- Mandatory Security
Every arrest application should require the applicant to lodge an appropriate deposit or bank guarantee. If the arrest is lifted, the wronged party could be compensated from this security immediately.- Practical aspect: The amount of the security would need to cover the anticipated damage, for instance the loss of charter income over a number of days or weeks.
- Flexible Mandatory Orders
A slightly more flexible model would maintain judicial discretion but require a clear statutory guideline specifying when a security must be posted (e.g. where the yacht’s value is disproportionately high).
3. Uniform Minimum Standards at International Level
3.1 Why an International Approach Is Needed
In the yacht industry, the “physical location of the yacht” is decisive: the owner or the flag state is often only of minor relevance if the yacht is within foreign territorial waters. A purely domestic reform may be helpful but does not solve the fundamental problem. A European or international initiative could establish common minimum standards for arrest and liability.
3.2 Possible Means
- EU Directive or Regulation
The EU has already introduced harmonised measures in other areas (e.g. the European Enforcement Order, European Order for Payment). An “EU Arrest Regime” could provide:- Uniform prerequisites for arrest.
- Mandatory security from the applicant.
- Strict rules on liability for wrongful arrests.
- Defined jurisdiction rules to prevent forum shopping.
- Modernising the Arrest Convention
The 1952 Arrest Convention is somewhat outdated; alternative conventions (e.g. the 1999 Convention) are not widely adopted. An international conference (e.g. via the IMO or CMI) could launch a reform to update the liability regime for wrongful arrests in line with contemporary charter and superyacht operations.
4. Introduction of Specific Proceedings Against Disproportionate Arrests
4.1 Accelerated Protective Mechanisms
To avoid yacht owners waiting days for the arrest to be lifted, states could integrate short deadlines and expedited review procedures into their procedural rules. A possible legal remedy would allow the owner to be heard in court within 24 hours, to have obviously disproportionate or manifestly unlawful arrest applications promptly overturned.
4.2 Interaction with Arbitration Clauses
Many (charter) contracts contain arbitration clauses, which in practice cannot entirely prevent a national court from ordering an arrest under its sovereign authority. A potential compromise would be a “reservation for arbitration”, allowing an arbitral tribunal to swiftly decide on the merits ex post, with the state court arresting the vessel only until the arbitral tribunal makes its determination.
5. Principle of Proportionality and Limitation Models
5.1 Capping the Scope of Security
If a claim is worth only, say, €10,000, but a yacht worth several million euros is seized, the imbalance is glaring. Thus, legislation could prescribe:
- Arrest only to the extent necessary to secure the claim and associated legal costs (i.e. not the entire yacht if the claim is relatively small).
- “Arrest light”: Physical arrest is permissible only if no other quickly accessible assets exist or if the creditor can substantiate that only the yacht itself is appropriate security.
5.2 Securing Charter Proceeds or Insurance Benefits
A progressive legal provision could require creditors first to proceed against charter proceeds, insurance payments or bank accounts before effecting a complete arrest of the vessel. This would be less harsh on the owner while still protecting the creditor’s interests.
6. Improving Compensation for Damages Through Clear Valuation Rules
6.1 Actual Loss or Fixed Sums?
Owners often struggle to prove the exact amount of damages (e.g. lost charter contracts, reputational harm). Statutory standardised or indicative damage calculations could be introduced:
- Fixed sums per day of arrest, based on standard charter rates.
- Reversal of the burden of proof: If the arrest is wrongful, it is presumed that all confirmed charter losses are to be compensated in full, without the owner having to demonstrate each booking in detail.
6.2 Consideration of Reputational and Consequential Damages
A codified system that recognises intangible or knock-on losses would guide courts to account for lost marketing opportunities and depreciation in value. This would, of course, need to be balanced by reasonable defences available to the arrest applicant.
7. Summary: Key Points for a More Equitable Solution
- Enhanced Applicant Liability: A revised liability regime – whether through strict liability or reversed burden of proof – ensures that those harmed by an arrest can realistically recover their costs, including consequential damages.
- Mandatory Security: Courts should require applicants to provide suitable security for any arrest application. If it later proves unjustified or disproportionate, the owner can be compensated directly from this fund.
- Proportionality Principle: Legally requiring that the extent of the arrest (the value of the property seized) must be proportionate to the principal claim (plus litigation costs and interest), with courts obliged to limit excessive arrests on their own motion.
- Accelerated Review: Introducing expedited procedures (e.g. rapid hearing dates) or a clear right of appeal, so that an unjustified arrest can be lifted within 24–72 hours rather than dragging on for weeks.
- International Harmonisation: An EU-wide measure or a modernisation of the Arrest Convention to set uniform minimum standards. This is vital for yachts that cruise across multiple Mediterranean jurisdictions, where a standardised framework would offer better protection.
- Fixed Compensation: If an arrest is found wrongful, the yacht owner should automatically receive specified entitlements (e.g. daily tariffs based on the charter rate), without having to undertake complicated proofs of loss.
Conclusion
The current legal environment in many countries makes it possible to arrest yachts with potentially devastating economic consequences, even if the claim to be secured is relatively minor and later proves unfounded. This situation neither serves the interests of a well-functioning maritime economy nor does it align with the principle of proportionality. Legislative reforms that tighten the applicant’s liability, require mandatory security, and ensure faster judicial scrutiny could counteract abuse.
In the long run, an internationally uniform approach, especially by modernising the Arrest Convention or introducing EU-wide minimum standards, would help ensure that victims of disproportionate arrests receive adequate protection. A clear and consistent legal framework would safeguard creditors’ legitimate interests while sparing yacht owners from bearing undue risks.