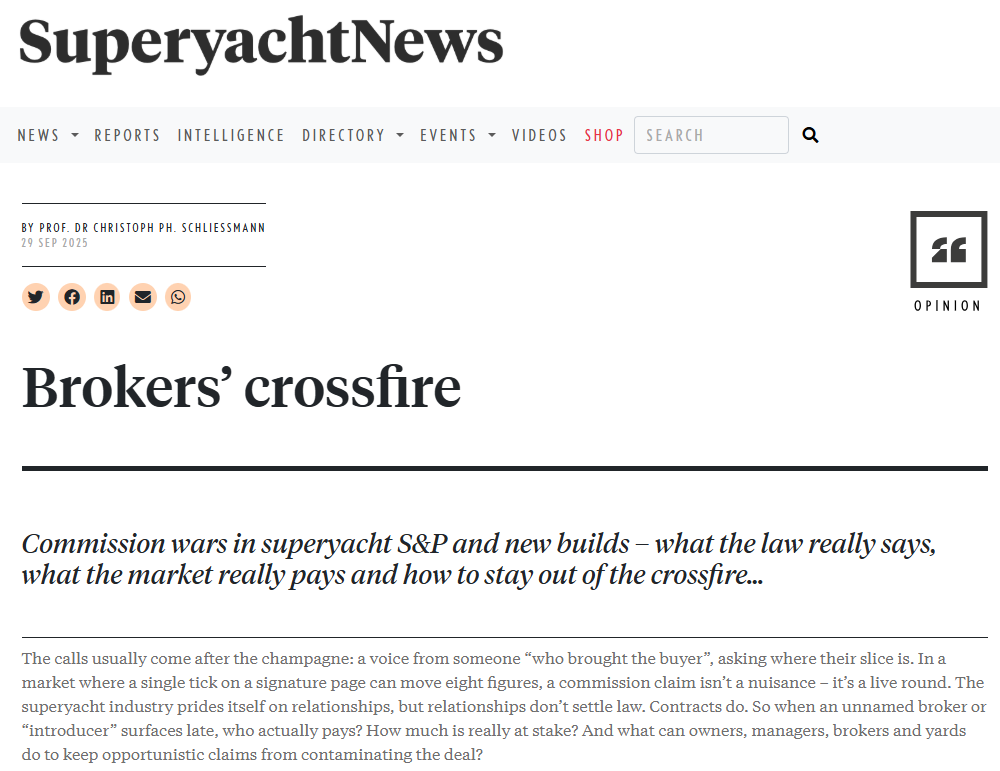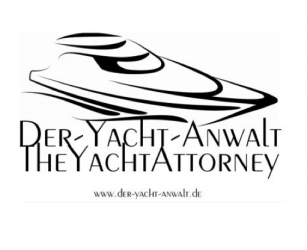Provisionsansprüche im Yachtkauf (MYBA E-MOA 2021) und beim Neubau – Rechtslage, Marktwerte & Schutz in der Praxis
Wer an einer größeren Yachttransaktion beteiligt ist, merkt schnell: Nicht das Verhandeln des Kaufpreises sorgt für die meisten Reibungen – sondern die Frage, wer wem welche Provision schuldet. Gerade heikel wird es, wenn nach Closing plötzlich ein „nicht benannter“ Broker auftaucht und behauptet, den Käufer „eingeführt“ zu haben. Der folgende Überblick ordnet die Rechtslage (englisches Recht/MYBA-Praxis), grenzt typische Marktwerte ein und zeigt, wie sich Parteien wirksam absichern.
Im Gebrauchtmarkt unter dem MYBA E-MOA 2021 ist die Rollenverteilung klar: Die Provision wird außerhalb der MOA in einer separaten, vertraulichen Commission Agreement zwischen Verkäufer und den benannten Broker(n) geregelt. Kommt es zum Konflikt, hat diese Provisionsvereinbarung Vorrang, ohne den Käufer – der nicht Vertragspartei der Commission Agreement ist – zu belasten oder zu benachteiligen. Dieses „Vorrang-und-Käuferschutz“-Prinzip ist in der Praxis seit Jahren Konsens und im E-MOA 2021 ausbuchstabiert.
Was aber, wenn ein nicht im Vertrag genannter Vermittler bezahlt werden will? Dann kann er sich regelmäßig nicht auf die MOA stützen, sondern muss einen eigenen Rechtsgrund beweisen. Unter englischem Recht bedeutet das typischerweise einen ausdrücklichen oder konkludenten Courtagevertrag mit der zahlungspflichtigen Partei – oder, seltener, die Drittbegünstigten-Durchsetzung nach dem Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (CRTPA), sofern der Hauptvertrag ihn (oder seine Klasse) klar begünstigt und CRTPA nicht ausgeschlossen ist. Leitentscheidungen wie Nisshin v Cleaves haben die Drittberechtigung von Maklern in passenden Klauselsettings bejaht; ohne solche Klausel bleibt nur der „effektive Ursache/Procuring-Cause“-Nachweis gegenüber demjenigen, der die Provision zugesagt hat.
Der Maßstab der „effektiven Ursache“ ist praxisnah: Eine bloße Namensnennung oder das flüchtige „Intro“ genügt nicht. Gefordert ist eine kausale Mitwirkung am tatsächlich abgeschlossenen Geschäft – dokumentiert etwa durch Besichtigungen, Sea Trial-Begleitung, Verhandlungsbeiträge und den roten Faden bis zur Unterzeichnung. Die Court of Appeal hat diesen Grundsatz in Foxtons v Pelkey Bicknell mit Blick auf Maklerprovisionen deutlich gemacht; hochwertige Praxisliteratur arbeitet den Prüfungsmaßstab präzise heraus.
Wie viel steht überhaupt auf dem Spiel? In der Brokerage-Praxis wird seit Jahren ein Korridor von bis zu 10 % des Kaufpreises als Benchmark beschrieben, häufig geteilt zwischen Listing- und Käuferbroker. Aktuelle Marktberichte und Branchenquellen bestätigen das Bild. Gleichzeitig zeigt die jüngste US-Klagewelle gegen ein vermeintliches „10 %-Kartell“: Der Richter hat 2025 die Sammelklagen abgewiesen – die Diskussion lässt den De-facto-Benchmark jedoch weiter präsent. Für Verhandlungen in Europa heißt das: Kenntnis der Benchmarks, aber vertragliche Feinsteuerung bleibt entscheidend.
Im Neubau verschiebt sich das Bild nochmals. Führende Werften – exemplarisch Benetti – verankern eine Provision (keine Doppelvergütung), zahlen pro rata zu Meilensteinraten und stellen klar, dass „casual introductions“ oder bloße Namensregistrierungen keinen Anspruch begründen. Verlangt wird eine substantielle Mitwirkung am Deal. Diese Policies haben in der Praxis einen spürbaren Filtereffekt gegen dünn belegte „Introducer“-Forderungen.
Die Rechtsprechung zu ganz großen Tickets unterstreicht außerdem, dass Quote ? Dogma ist: Im prominenten „DARIUS“-Komplex (Berezovsky v Edmiston) stritt man über die angemessene Vergütung; der Bericht aus den Verfahren zeigt, dass 2,5–3 % in diesem Segment als vertretbar angesehen wurden – und zwar auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Genau deshalb lohnt sich im High-End-Bereich ein gezielter Quantum-Meruit-Blick auf Leistung, Marktlage und Risikoprofil.
Hilft Regulierung gegen „Trittbrettfahrer“-Ansprüche? Teilweise ja. Dort, wo Lizenz- und Escrow-Pflichten gelten – etwa nach dem Florida Yacht and Ship Brokers’ Act (Ch. 326) –, sorgen Bonds, Treuhandkonten und Schriftformerfordernisse für Transparenz und Disziplin. Europa/UK kennen keine einheitliche staatliche Lizenzierung; hier tragen Verbandsstandards (MYBA/IYBA/ABYA/CPYB) und saubere Vertragsarchitektur die Hauptlast der Streitvermeidung.
Wie schützt man sich wirksam? Erstens, durch konsequente Dokumentation des Kausalverlaufs (E-Mail-Kette, Besichtigungs- und Verhandlungsprotokolle, Teilnehmerlisten). Zweitens, durch klare Vertragstechnik: Im MYBA-Setting gehört dazu eine separate Commission Agreement mit namentlicher Benennung sämtlicher Broker, präziser Quotenregel und Vorrangklausel zur MOA; flankierend die „Named Brokers only“-Logik samt gegenseitiger Freistellungen gegen Drittansprüche. Drittens, eine bewusste CRTPA-Klausel: Der 1999-Act wird grundsätzlich ausgeschlossen, außer zugunsten der ausdrücklich benannten Broker – so wird ungewollte Drittklagebefugnis sauber ausgesperrt. Viertens, gerade im Neubau, die Werft-Commission-Policy früh einbinden: eine Provision, pro rata-Zahlung, kein Automatismus für Folgeaufträge, Namensregistrierung ? Anspruch. All das reduziert den Angriffsraum für späte, dünn belegte Forderungen spürbar.
Fazit: Die harte Währung in Provisionsstreitigkeiten sind Kausalität und Klarheit. Wer im Vertrag eindeutig adressiert, wer bezahlt, wer überhaupt Broker ist und wann die Provision verdient wird, und wer gleichzeitig die „effective cause“ auch dokumentieren kann, macht Provisionsklagen Dritter weitgehend zahnlos – im Gebrauchtmarkt wie im Neubau.
Hinweis: Der Beitrag spiegelt primär englisches Recht & MYBA-Praxis wider (häufige Rechtswahl/Schiedssitz in Yacht-S&P). Abweichungen je nach Rechtswahl sind möglich; in Neubau-Fällen kommt die Werft-Policy hinzu.
The Broker’s Cut: who pays, when, and how much?
Commissions in yacht S&P under the MYBA E-MOA (2021) and in new builds — law, market practice, and how to stay out of trouble
If there’s one topic that can sour an otherwise smooth yacht deal, it’s commission. The crew may be polishing the rail for delivery, yet a late-arriving “introducer” appears claiming they brought the buyer and want a slice. Who, if anyone, owes them money? Under the MYBA E-MOA 2021, the architecture is clearer than ever. Commission is ring-fenced into a separate, confidential commission agreement between the seller and the named broker(s). The MOA itself points to that separate agreement, confirms that the seller pays on completion out of the sale price, and—crucially—adds that if there’s any conflict between MOA and commission agreement, the commission agreement prevails without prejudicing the buyer, who is not a party to it. That captures long-standing practice and reduces scope for surprise claims against buyers.
Older MYBA forms already signposted the essentials. The 2005 specimen shows the parties recognising the named broker(s) only, fixing seller-only liability for remuneration, and including mutual indemnities against claims from anyone else alleging involvement. That historical pattern explains the modern E-MOA’s commission “firewall”: name the actors, keep the buyer out of harm’s way, and channel all remuneration through a dedicated agreement.
So what if a broker isn’t named? In general, they can’t ride on the MOA. Under English law (the most common governing law for MYBA S&P), they must prove a stand-alone right—typically a contract with the paying principal, or the ability to enforce a promise in the sale/build contract as a third party under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (CRTPA). Section 1 of CRTPA allows a non-party to enforce a term that purports to confer a benefit on them; but it is equally clear that the contracting parties can exclude that right. That is why sophisticated S&P documentation often excludes CRTPA except in favour of the specifically named brokers.
The leading shipping case Nisshin v Cleaves pulls these strands together. There, commission clauses in charterparties “purporting to confer a benefit” on brokers were enforceable by those brokers as third parties (and they could also rely on the arbitration clauses), because the contracts hadn’t excluded CRTPA. The lesson for yacht S&P is simple: if you don’t want unnamed third parties suing on your paper, say so expressly—and still put the real commission deal in a dedicated agreement.
Even with a valid contractual route, a claimant broker normally must clear the “effective (or procuring) cause” hurdle: being the cause of the actual transaction that completed. Mere name-dropping rarely suffices. The principle—well-articulated by the Court of Appeal in Foxtons v Pelkey Bicknell—is that success-based commission presupposes that the agent’s work truly caused the successful deal. Where another agent picked up the thread and turned a cold lead into a purchase months later, the first agent’s claim can (and in Foxtons did) fail.
When is commission earned? Under the MYBA sale, on completion—and the E-MOA text now says exactly that, dovetailing MOA and commission agreement. By contrast, new-build practice often ties broker remuneration to the buyer’s milestone payments. A good example is Benetti’s Standard Commission Policy: one commission only per contract; payment pro rata to instalments; and “casual introductions” or mere name registration are not enough—the broker must show tangible involvement (yard visits, technical and contractual negotiations, and so on) that effectively enables the contract. That approach cuts off speculative “I once mentioned the yard at a boat show” claims at the root.
How much is “at stake”? In brokerage resales, ~10% of the gross price remains the benchmark in market guides and trade press, typically split between listing and buyer’s brokers. Recent U.S. litigation spotlighted the topic by attacking the 10% norm on antitrust grounds; but in January 2025 a federal judge in Florida dismissed consolidated class actions, and the claims failed to establish a commission-fixing conspiracy. Whatever one’s policy view, the 10% reference point still frames many negotiations globally. In the upper reaches—very-large yachts and complex deals—the number can be lower and bespoke. The “DARIUS” appeal (Berezovsky v Edmiston) is often cited, with the court reasoning around 2.5–3% on a €240m sale after sifting the evidential record. Context matters, but it shows that quantum can be argued as “what’s reasonable” where no fixed rate ultimately binds.
Would regulation reduce “ghost broker” problems? To a degree, yes. Jurisdictions like Florida and California require yacht brokers to be licensed, keep escrow/trust accounts, and—for Florida—post a $25,000 bond. Those rules generate paper trails and enforcement hooks (audits, penalties), which in turn discourage opportunistic claims. Europe and the UK lack a unified licensing regime for yacht brokers, so contract clarity and industry standards (MYBA/IYBA/ABYA/CPYB) do most of the heavy lifting there.
How do you keep your deal safe? Start by naming the brokers and capturing the real economics in a separate commission agreement that the MOA recognises as controlling—all standard under the E-MOA. Add a CRTPA clause: no third-party rights except for the brokers named here. Define procuring/effective cause to avoid “casual intro” arguments. In new builds, align the yard–broker agreement to yard policy (one commission; pro-rata to milestones; no automatic commission on future orders). Above all, document the chain of causation—viewings, sea trial attendance, negotiation minutes—so that if a late claimant emerges, the evidence speaks for itself.
Bottom line: Commission fights are won with clarity (instruments that say who pays what, when, and to whom) and causation (records proving who actually got the deal done). Do those two things well, and most after-the-fact claims never get traction.